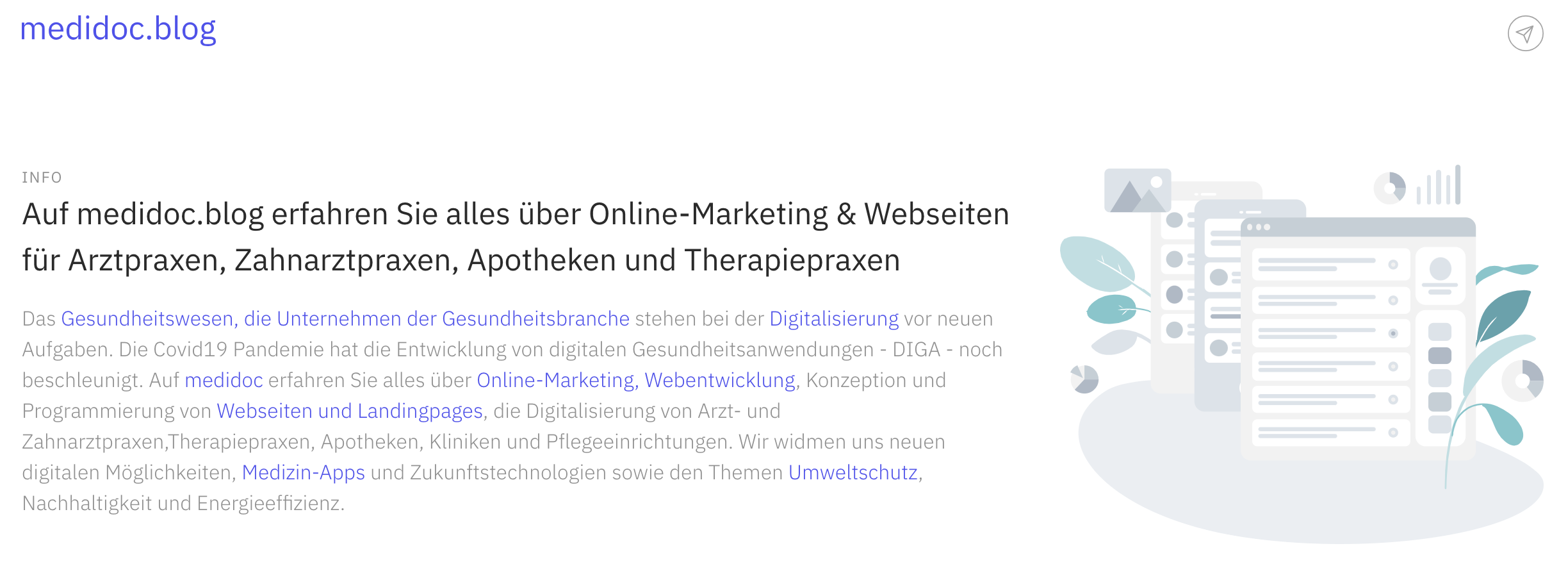Chancen und Herausforderungen der elektronischen Patientenakte
Die elektronische Patientenakte (ePA) wird 2025 flächendeckend in Deutschland eingeführt und revolutioniert die Art und Weise, wie Gesundheitsdaten verarbeitet und geteilt werden. Als Herzstück der digitalen Gesundheitsversorgung bietet sie neue Möglichkeiten für Patientinnen, Ärztinnen, Therapeut*innen, Krankenhäuser und Apotheken. Doch welche Chancen eröffnet sie wirklich, und welche Herausforderungen müssen bewältigt werden?
Was ist die ePA und warum ist sie so wichtig?
Die ePA dient als zentrale Plattform zur Speicherung und Vernetzung von Gesundheitsdaten. Sie ermöglicht den sicheren Austausch von Informationen zwischen Ärzt*innen, Krankenhäusern, Apotheken und Krankenkassen. Zudem fungiert sie als digitales Dashboard für Gesundheitsanwendungen wie DiGA (Digitale Gesundheitsanwendungen), Medikationspläne (eMP) und medizinische Apps.
Die ePA ist ein wesentlicher Schritt in Richtung einer vernetzten und nachhaltigen Gesundheitsversorgung, indem sie interdisziplinäre Zusammenarbeit fördert und Patient*innen in den Mittelpunkt stellt.
Die Vorteile der ePA im Überblick
- Transparente Krankengeschichte: Ärzt*innen können auf vollständige Patientendaten zugreifen, um individuelle Behandlungspläne zu erstellen.
- Sichere Medikamentenversorgung: Apothekerinnen und Ärztinnen erkennen frühzeitig Wechselwirkungen und Unverträglichkeiten.
- Digitale Medikationspläne: Patient*innen behalten den Überblick über Einnahmezeiten und Dosierungen.
- Effizientere Behandlungen: Chronische Erkrankungen und Kontrolltermine werden besser organisiert.
- Vermeidung von Doppeluntersuchungen: Das spart Zeit und reduziert Kosten.
- Umweltfreundlichkeit: Papierloser Datenaustausch schont Ressourcen und reduziert den CO₂-Fußabdruck.
- Datensicherheit: Strenge Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) schützt sensible Gesundheitsdaten.
- Schnelle Verfügbarkeit: Wichtige Dokumente wie Arztbefunde, Röntgenbilder oder Medikationspläne sind jederzeit über die ePA-App abrufbar.
Herausforderungen bei der Einführung der ePA
- Technische Infrastruktur: Viele Praxen und Krankenhäuser benötigen Investitionen in IT-Systeme, um die ePA nahtlos zu integrieren.
- Datenschutzbedenken: Die sichere Verarbeitung sensibler Gesundheitsdaten erfordert umfassende Aufklärung und Vertrauen.
- Schulungen: Ärzt*innen, Pflegepersonal und Apotheken müssen geschult werden, um die ePA effizient nutzen zu können.
- Akzeptanz bei Patient*innen: Ältere oder technikunerfahrene Menschen könnten Schwierigkeiten bei der Nutzung haben.
Das Potenzial der ePA: Ein Schritt in die Zukunft
Die ePA steht symbolisch für den Übergang zu einer digitalen, patientenzentrierten Gesundheitsversorgung. Neben der Effizienzsteigerung und der Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit trägt sie auch zur Nachhaltigkeit bei.
Das Bundesgesundheitsministerium betont die Bedeutung der ePA als Meilenstein der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Ihr Erfolg hängt jedoch maßgeblich davon ab, wie gut technische, rechtliche und soziale Herausforderungen gemeistert werden.
Die ePA als Schlüssel zur vernetzten Gesundheitsversorgung
Die flächendeckende Einführung der elektronischen Patientenakte ist ein großer Schritt nach vorn. Sie schafft neue Chancen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und hilft, die Versorgung effizienter, nachhaltiger und sicherer zu gestalten. Jetzt liegt es an den Akteur*innen, die ePA erfolgreich in die Praxis umzusetzen und ihre Potenziale voll auszuschöpfen.
Erklärung des Bundesgesundheitsministeriums zum Thema ePA – elektronische Patientenakte.

weitere Informationen:
Das E-Rezept die E-Verordnung e-Rezept
Der Elektronische Medikationsplan eMP
Die elektronische Patientenakte ePA
Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung eAU
Die Gematik veröffentlicht auf Ihrer Webseite neue Entwicklungen, neue Anwendungen für die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Erklär-Videos vermitteln die Funktionen und Möglichkeiten druch die ePA anschaulich. Die meisten Krankenkassen bieten eigene Apps für die elektronische Patienten an.
Eine Liste mit den Krankenkassen, das Angebot an ePA-Apps, findet sich auf der Webseite der Gematik